DER HAUPTSTADTBRIEF
Die soziale Seite der Sozialen Marktwirtschaft
Ohne soziale Sicherheit wird der Wirtschaftsfreiheit auf Dauer kein Erfolg beschieden sein | Von Horst Friedrich Wünsche
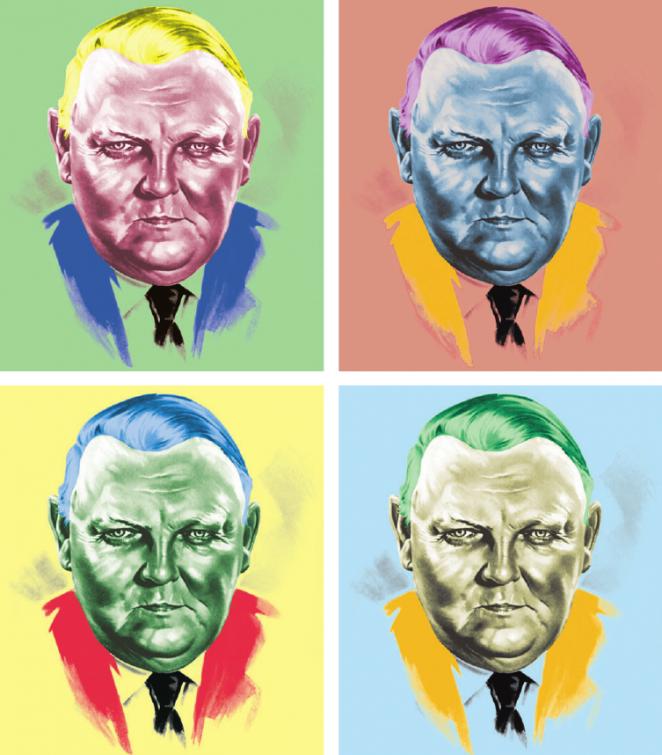
Erhard hielt die Wirtschaftspolitik, die in den 1960er-Jahren zunächst an den Hochschulen diskutiert und 1967 mit dem „Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft“ parlamentarisch durchgesetzt wurde, für unvereinbar mit den Grundsätzen marktwirtschaftlicher Politik. Er sah in der staatlichen „Globalsteuerung“ der Wirtschaftsaktivitäten und dem damit verbundenen Verzicht auf ausgeglichene öffentliche Haushalte den Beginn einer verhängnisvollen Entwicklung hin zu wachsender Staatsverschuldung. Und er befürchtete im Hinblick auf die „Konzertierte Aktion“, mit der Gewerkschaften und Spitzenverbände der Wirtschaft in politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden sollten, eine Begünstigung von „partikulären Funktionärsinteressen“ und eine zunehmende Entlastung der Wirtschaft von notwendigen Haftungsverpflichtungen und sozialen Rücksichten.
Ludwig Erhard hatte es schwer, Verständnis für seine Bedenken zu finden. In der Hauptsache lag das wohl daran, dass das vorrangige Ziel des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes, stetiges Wirtschaftswachstum zu sichern, ein Sachverhalt war, den Erhard mit seiner Politik erreicht hatte. Verkannt wurde dabei jedoch, dass Erhard Wachstumspolitik niemals als Staatsaufgabe angesehen hat. Für ihn war es Angelegenheit der Unternehmer, sich im Rahmen der gegebenen Wirtschaftsordnung optimal einzurichten und herzustellen, was gebraucht wird. Und tatsächlich waren die hohen Wachstumsraten in der Wiederaufbauzeit zwar im Rahmen einer sorgfältig errichteten und überwachten Wettbewerbsordnung, aber vorwiegend durch private Initiative, also ohne staatliche Wirtschaftsförderung und häufig sogar in Widerspruch gegen Wirtschaftsinteressen entstanden.
Wachstum war Ergebnis, aber nicht Ziel der Erhard’schen Wirtschaftspolitik, und dementsprechend war Erhards Augenmerk auch nicht auf das Entstehen, sondern in erster Linie auf die sozial gerechte Verteilung der wirtschaftlichen Fortschritte gerichtet. Erhard ging es nicht um „Wohlstand über alles“, sondern um „Wohlstand für alle“, wie 1957 sein Bestseller-Buch hieß, und folglich nicht um Förderung der Wirtschaft, sondern um eine Politik, mit der die Beteiligung aller an wirtschaftlichen Fortschritten gewährleistet wird, also um Vollbeschäftigung und leistungsgerechte Entlohnung.
Eine Schwierigkeit für das Verständnis von Erhards politischen Ansichten war sicherlich auch, dass sich seine Motive und Überzeugungen keiner vorherrschenden politischen Doktrin zuordnen ließen. Ludwig Erhard galt zu Beginn seiner politischen Karriere als „Linksliberaler“. Später wurde er der Gruppe der eher konservativen deutschen Neoliberalen zugeordnet. Erhard meinte, diese Zuordnung „möge geschehen. Ich wehre mich nicht dagegen“. Er betonte jedoch, dass er nicht das „liberalistische Freibeutertum einer vergangenen Ära“ vertrete und „nicht mit Floskeln wie dem ,freien Spiel der Kräfte‘ und dergleichen Phrasen hausieren gehe“ (Ludwig Erhard in einer Rede am 21. April 1948 in Frankfurt am Main). Im Übrigen sei er Schüler des „liberalen Sozialisten“ Franz Oppenheimer und einiger Professoren aus dem Kreis der „Katheder- Sozialisten“, allen voran von Wilhelm Rieger.
Mir sind Inhalt und Bedeutung von Ludwig Erhards politischer Position erst klar geworden, als mir Erhard empfahl, die Briefe zu lesen, die Alfred Döblin einem jungen Studenten geschrieben hatte. (Wissen und verändern! Offene Briefe an einen jungen Menschen, S. Fischer, Berlin 1931, Seiten 173 f.) Seit dieser Lektüre halte ich Erhards politische Konzeption – seine Soziale Marktwirtschaft – für ein ähnliches Bemühen, wie es Leszek Kolakowski dem Bernstein’schen Revisionismus bescheinigt hat: für eine „sozialistische Rekonstruktion des Liberalismus“ (so in: Die Hauptströmungen des Marxismus, Band 2, Piper, München 1978, Seite 134.) Von daher bedauere ich, dass Erhards wirtschafts- und sozialpolitische Konzeption in der SPD niemals als Fundament einer zukunftweisenden Politik erwogen wurde.
Für viele Sozialisten, auch für Döblin, stand fest, dass das Marxsche Kapital die historisch begründete Theorie vom Entstehen und der Entwicklung sozialer Gegensätze und des modernen Klassenkampfes, aber kein Programm für die Übernahme und die Fortführung der Produktion durch die Arbeiterklasse und die Verteilung des Sozialprodukts war. Mit dem Sieg der Arbeiterschaft 1918 sei die Person zugunsten des Kollektivs ausgelöscht worden. Dementsprechend lautete Döblins Appell an die sozial wachen Intellektuellen innerhalb der Arbeiterschaft: „Erhebung der Person, des Individuums!“ Ein Rezensent dieser Schrift, der zu seiner Zeit bedeutende Chronist und Kritiker Samuel Saenger, notierte dazu treffend: „Sozialismus? Wir nennen dieses gesellschaftliche Ideal humanen Liberalismus, zum Unterschied von dem ökonomischen.“ (Führer und Verführer, in: Die neue Rundschau, 1931, Band 42, Seite 562.)
Ludwig Erhard hat mit seiner Politik Raum für private Initiativen geschaffen und damit den ökonomischen Liberalismus anerkannt. Das aber nur so weit, wie garantiert werden kann, dass die privaten Wirtschaftskräfte tatsächlich zum Nutzen von Verbrauchern und Arbeitnehmern wirken. Mit der Idee eines humanen Liberalismus unvereinbar hingegen hielt er die nur am eigenen Nutzen und Gewinn orientierten Handlungen, jede Wettbewerbsbeschränkung, jeden Betrug, jede Ausbeutung von Schwächeren und auch die Neigung von Unternehmen, ihre Produktionsstandorte an den Heimstätten billiger Arbeitskräfte zu errichten, um nicht die Leistungslöhne zahlen zu müssen, die auf den Absatzmärkten verrechnet werden. Wichtig für Erhard war zudem, soziale Aufstiegschancen zu sichern und die Bildung von in sich geschlossenen Managerkasten zu verhindern.
In Deutschland fehlen gegenwärtig nicht nur detaillierte Kenntnisse der wissenschaftlichen Grundlagen von Ludwig Erhards Politik, sondern auch das Bewusstsein für die aktuelle Bedeutung von Erhards „humanem Liberalismus“. Das jetzt vorherrschende Denken – der ökonomische Liberalismus, den viele aggressiv zur Rechtfertigung ihrer Sonderinteressen nutzen – hat das soziale Denken in einen Bannkreis verwiesen, in dem es endlos und unergiebig gegen wirtschaftliche Interessen kämpft. Diesen Bannkreis gilt es zu überwinden: Soziale Sicherheit muss wieder – wie in der von Erhard geprägten Ära – gleichrangig neben der Aufgabe stehen, eine freiheitliche Wirtschaftsordnung zu sichern.
Fest steht, dass diese Aufgabe schwierig zu lösen ist, dass man ihr aber nicht ausweichen kann; denn eine freiheitliche Ordnung – eine Ordnung, in der auf staatliche Lenkung und Gängelung verzichtet wird – ist Gebot der Menschenwürde. Ein ernsthaft durch geführter Verzicht auf staatliche Eingriffe in die Wirtschaft bedeutet aber, dass sich die Wirtschaftsergebnisse im anonymen Marktprozess sozial gerecht verteilen müssen, damit keine nachträglichen Verteilungskämpfe stattfinden. Da es aber keine Marktwirtschaft gibt, in der eine „unsichtbare Hand“ den privaten Egoismus in sozial tolerable Effekte verwandelt, bleibt nichts anderes übrig, als die Marktwirtschaft sorgsam zu einer Ordnung umzugestalten, an deren Ergebnissen automatisch alle teilhaben. Ohne eine für jeden Einzelnen sichtbare Parität von Wirtschaftsfreiheit und sozialer Sicherheit zerfällt jede Sozialordnung in Verteilungs- und Klassenkämpfen.
Ludwig Erhard hat mit dem wirtschaftlichen Erfolg seiner Sozialen Marktwirtschaft bewiesen, dass eine Marktwirtschaft, die frei von staatlichen Lenkungen und korporativen Absprachen bleibt, in einem stetig fortschreitenden Prozess zu Vollbeschäftigung führen und einen Zustand erreichen kann, in dem alle Erwerbstätigen am steigenden Wohlstand teilhaben und soziale Umverteilungen weitgehend durch Selbstvorsorge ersetzt werden können. So gesehen ist der 30. November 2016 dann eben doch ein erinnerungswürdiges Datum: die 50. Wiederkehr des Tages, an dem ein Politiker die Bonner Bühne verließ, der von Wirtschaft etwas verstand und dieses Wissen als politisch Verantwortlicher in Wohlstand für alle ummünzen konnte.
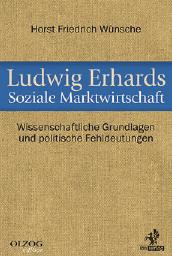
460 Seiten, gebunden 34 Euro, als E-Book 24,99 Euro.

