DER HAUPTSTADTBRIEF
Warum die EU jetzt „Plan C“ aus der Schublade holen sollte
Vertrauensverlust bestimmt die Lage in der EU. Dabei wäre kurzfristige Besserung möglich – durch Anwendung des Anti-Brexit-Reformplans, trotz Brexit | Von Michael Wohlgemuth
Die Reaktionen, die wir jetzt erleben, erinnern an das Jahr 2005, als eine geplante „Verfassung für Europa“ nicht zustande kam, weil sie in Referenden in Frankreich und den Niederlanden durchfiel. Auch damals gab es zuerst Fassungslosigkeit, gefolgt vom Versprechen, die Lehren zu ziehen und nach einer „Reflexionsphase“ einen „Plan D“ vorzulegen – D wie Demokratie. Nach Jahren weitgehend ergebnisloser Reflexion wurde jedoch entschieden, mit Plan A weiterzumachen – A wie in Alles beim Alten. Die gescheiterte europäische Verfassung wurde von etwas Pathos befreit und umbenannt in „Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft“. Die Franzosen und Niederländer wurden diesmal nicht nach ihrer Zustimmung gefragt.
Seither verweilt die EU im Krisenmodus – wenn nicht im Ausnahmezustand. Zwar gibt es viele Pläne für „mehr Europa“ oder ein „besseres Europa“ auf wichtigen Feldern wie der Sicherung der EU-Außengrenzen, der Terrorismusbekämpfung oder des Binnenmarkts für Digitales und Energie. Ein „Plan D“, der auf die Klagen über mangelnde demokratische Kontrolle und subsidiäre Verantwortung eine Antwort liefern würde, wird indes nicht einmal diskutiert. Gleichzeitig gefällt man sich in Brüssel in ungewohnter Bescheidenheit. Die Vision von den „Vereinigten Staaten von Europa“ wird derzeit kaum noch bemüht – ironischerweise exakt 70 Jahre, nachdem Winston Churchill im September 1946 genau das in seiner berühmten Züricher Rede „Let Europe Arise“ gefordert hatte.
Der Anti-Brexit-Plan vom Februar 2016 hätte das Zeug, auf die EU selbst angewendet die Union zum Besseren zu verändern.
Die aktuelle Ernüchterung ist ohne Zweifel auch eine Folge des neu aufkommenden Nationalismus populistischer Kräfte von rechts und links. Die gute Nachricht: Ein Sprung nach vorn hin zu einer übermäßigen Zentralisierung und Harmonisierung ist damit vorerst ausgebremst. Die schlechte Nachricht: Gleichzeitig droht die zunehmende Popularität nationalistischer Bestrebungen einen Sprung zurück zu provozieren – weg von den liberalen Errungenschaften der europäischen Integration, weg von offenen Märkten, von Freihandel, Toleranz und grenzüberschreitender Zusammenarbeit.
Viele halten es nun für geraten, die Briten für ihre „unkluge“ Entscheidung zu bestrafen, um Nachahmer abzuschrecken. Das wäre eine gefährliche Strategie. Es hieße, wieder künstliche Handelsbarrieren zu errichten, um Großbritannien die volle Teilhabe am EU-Binnenmarkt – aber womöglich auch an anderen gegenseitig vorteilhaften EU-Initiativen – zu erschweren. Eine solche Strategie würde auf geradezu sado-masochistische Weise das europäische Projekt mehr beschädigen, als es jede andere Dummheit zuvor vermocht hatte. Zumal es auch anders ginge: Statt auf Abschreckung zu setzen, ließe sich sogar die Attraktivität der EU steigern, um so weitere Exits unwahrscheinlicher zu machen.
Und ein solcher Plan plus Reformpaket liegt in der Tat bereits vor, er müsste gar nicht neu erfunden werden. Und: Alle 28 Mitgliedsstaaten haben ihn gutgeheißen. Man könnte ihn „Plan C“ nennen – C wie David Cameron. Die in dem Anti-Brexit-Plan vom Februar 2016 enthaltenen Reformen hatten das Motiv, Großbritannien – immerhin Europas zweitgrößte Volkswirtschaft und älteste parlamentarische Demokratie – durch die Gewährung von Zugeständnissen in der EU zu halten. Der entsprechende Ratsbeschluss ist zwar rechtlich nun hinfällig, da er nur im Fall eines Verbleibs Großbritanniens in der EU in Kraft getreten wäre, auch hätte er in Teilen nur auf Großbritannien bezogen gegolten. Dessen ungeachtet aber hätte er, statt auf Großbritannien nun auf die Rest-EU bezogen, politisch das Zeug, das Unbehagen zu mildern und die EU zum Besseren zu verändern.
Die folgenden fünf Punkte der Erklärung vom Februar 2016 ließen sich nämlich statt nur auf Großbritannien auf die gesamte EU übertragen:
Flexible Integration.
Die Bezugnahme in den EU-Verträgen auf den Prozess einer „immer engeren Union der Völker Europas“ ist vereinbar mit „verschiedenen Wegen der Integration für verschiedene Mitgliedstaaten“ der EU. Das ist als ein Bekenntnis dazu zu sehen, dass das Einheitsprinzip des „One-size-fits-all“ durchaus nicht das Grundprinzip der EU sein muss und eine flexible Geometrie der Integration der Willigen und Fähigen ein durchaus vertragskonformes Modell wäre. Das könnte in vielen EU-skeptischen Ländern den Widerwillen gegen gleichmacherische Bevormundung aus Brüssel verringern.
Fairness zwischen Euro- und Nichteuro-Ländern.
Weitere Schritte zur Vertiefung dürfen weder zu einer Diskriminierung der Nicht-Eurostaaten führen, noch haften diese für Rettungsschirme der Eurozone. Und daran sollte man festhalten, wenn man nicht in Ländern wie Tschechien, Dänemark, Polen oder Ungarn den EU-Kritikern weiter Munition liefern will. Dass dem Euro nur entgehen kann, wer aus der EU austritt – das ist keine Strategie mit gemeinsamem Zukunftspotential.
Subsidiarität und Demokratie.
Nationale Parlamente können mit einer verbindlichen Subsidiaritätsrüge („rote Karte“) aus ihrer Sicht übergreifende Rechtsakte verhindern. Eine solche Regelung könnte helfen, dem Vorwurf der Bürgerferne und des Demokratiemangels künftig weniger Ursache zu liefern.
Freizügigkeit und Sozialsysteme.
Der Zugang von EU-Ausländern zu bestimmten Sozialleistungen kann für eine Anfangszeit von einigen Jahren beschränkt werden. Die Zahlung von Kindergeld für Kinder, die im EU-Ausland verblieben sind, kann an die dortigen Lebenshaltungskosten angepasst werden. Die Befürchtung einer zahlenmäßig großen Migration in die Sozialsysteme (anstatt in den Arbeitsmarkt) ist gerade in Deutschland, Schweden, den Niederlanden oder Dänemark groß und schürt dort Stimmungen gegen die EU. Man sollte allgemeingültige, faire Regelungen der Personenfreizügigkeit vereinbaren können.
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.
Dazu ist die Erklärung vom Februar 2016 recht vage – immerhin sollen der „Verwaltungsaufwand und die Befolgungskosten für die Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, gesenkt und unnötige Rechtsvorschriften aufgehoben“ werden. Hier wäre noch Platz für „mehr Europa“. Der offene Binnenmarkt für Dienstleistungen ist noch längst nicht „vollendet“, und der für Energie und Digitales wird gerade erst angedacht – ebenso wie eine echte Kapitalmarktunion.
Die EU hätte also jetzt – nachdem der Cameron-Deal trotz der geplanten Zugeständnisse geplatzt ist und der Brexit stattgefunden hat – die Chance, das praktischerweise bereits vorhandene und abgenickte Paket in weiten Teilen als Reformagenda für die EU, wenn auch ohne Großbritannien, umsetzen. Denn schließlich war ja genau das das Ziel von Plan C – die Desintegration der EU zu verhindern. Zugegeben: Was die Briten betrifft, hat das Zugeständnisse-Paket seinen Zweck nicht erfüllt. Und es wäre selbstverständlich auch nicht dazu angetan, die EU langfristig auf einen neuen Kurs zu bringen – dazu sind weitaus fundamentalere Reformen notwendig. Als ein erster Schritt in die richtige Richtung aber würde die Anwendung von Plan C zumindest belegen, dass die EU reformwillig und reformfähig ist. Auch wenn es nur einen kleinen Schritt voran ginge – besser als ein neuerliches Zurückrudern zu Plan A – wie in Alles beim Alten – wäre es allemal. Der Rückfall in einen Status quo wäre fatal, weil die EU dann gänzlich scheitern könnte.
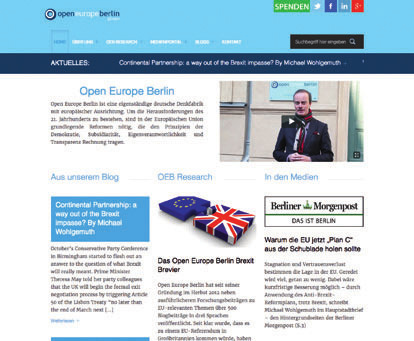
Mehr finden Sie auf der Website

